Neujahrsempfang 2014
Auch im neuen Jahr steht der Bürgerverein vor großen Aufgaben
Noch nie gab es beim Neujahrsempfang des Bürgervereins so viele Gäste. Sie durften sich zum Auftakt und der Umrahmung des Programms an den vielfältigen mehrstimmigen Liedern des neu gegründeten Chores der Seelsorgeeinheit Freiburg-West, der von Frank Barrois dirigiert wird, erfreuen.
 Nicolai Bischler, Vorsitzender des Bürgervereins Betzenhausen-Bischofslinde, durfte neben Bürgermeisterin Gerda Stuchlik eine Vielzahl von Gemeinderät(inn)en, Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister der Partnergemeinde Teningen, sowie Vertreter der Kirchen, Schulen und Vereine begrüßen. Das vergangene Jahr sei, so meinte Bischler, von viel Bewegung und Action gekennzeichnet gewesen. Der Redner hob einige wichtige Aufgaben hervor, die zumindest in wesentlichen Teilen abgearbeitet werden konnten: Im Juni 2013 konnte der erste Teil von ZAK (Zentrenaktivierungskonzept) mit der Einweihung des neu gestalteten Platzes im Geschäftszentrum Bischofslinde abgeschlossen werden. Es war das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit von Bürgerverein, SUBI (Sundgauallee/Bischofslinde) und interessierten Mitbürgern und Mitbürgerinnen unter der Leitung des GuT (Garten- und Umweltamt). Ganz besonders dankte Nicolai Bischler Yves Strittmatter vom Amt für Projektentwicklung und Stadterneuerung. Mit Blick auf das schön verlaufene Einweihungsfest werde man, so Bischler, auch dieses Jahr am 27. Juni ein kleines Sommerfest veranstalten.
Nicolai Bischler, Vorsitzender des Bürgervereins Betzenhausen-Bischofslinde, durfte neben Bürgermeisterin Gerda Stuchlik eine Vielzahl von Gemeinderät(inn)en, Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister der Partnergemeinde Teningen, sowie Vertreter der Kirchen, Schulen und Vereine begrüßen. Das vergangene Jahr sei, so meinte Bischler, von viel Bewegung und Action gekennzeichnet gewesen. Der Redner hob einige wichtige Aufgaben hervor, die zumindest in wesentlichen Teilen abgearbeitet werden konnten: Im Juni 2013 konnte der erste Teil von ZAK (Zentrenaktivierungskonzept) mit der Einweihung des neu gestalteten Platzes im Geschäftszentrum Bischofslinde abgeschlossen werden. Es war das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit von Bürgerverein, SUBI (Sundgauallee/Bischofslinde) und interessierten Mitbürgern und Mitbürgerinnen unter der Leitung des GuT (Garten- und Umweltamt). Ganz besonders dankte Nicolai Bischler Yves Strittmatter vom Amt für Projektentwicklung und Stadterneuerung. Mit Blick auf das schön verlaufene Einweihungsfest werde man, so Bischler, auch dieses Jahr am 27. Juni ein kleines Sommerfest veranstalten.
 Das ZAK sei noch nicht abgeschlossen, meinte Bischler. Jetzt gehe es an die Umgestaltung der Sundgauallee und des Betzenhauser Torplatzes. Die Bürger(innen) sollen alle mit den Planungen konfrontiert werden. Dazu wird es am 12. Februar einen Informationsabend geben. Die Partnerschaft mit Teningen brachte eine Reihe schöner Begegnungen, bei denen viele neue Kontakte entstanden seien. Vorbereitet wurden die Begegnungen vom Arbeitskreis Teningen, der gerne noch einige Mitarbeiter(innen) aufnehmen würde. Auch für 2014 sind schon einige gemeinsame Treffs geplant, darunter die Besichtigung der Käserei Monte Ziego am 13. Februar und die Besichtigung des Rebay-Hauses am 18. Mai.
Das ZAK sei noch nicht abgeschlossen, meinte Bischler. Jetzt gehe es an die Umgestaltung der Sundgauallee und des Betzenhauser Torplatzes. Die Bürger(innen) sollen alle mit den Planungen konfrontiert werden. Dazu wird es am 12. Februar einen Informationsabend geben. Die Partnerschaft mit Teningen brachte eine Reihe schöner Begegnungen, bei denen viele neue Kontakte entstanden seien. Vorbereitet wurden die Begegnungen vom Arbeitskreis Teningen, der gerne noch einige Mitarbeiter(innen) aufnehmen würde. Auch für 2014 sind schon einige gemeinsame Treffs geplant, darunter die Besichtigung der Käserei Monte Ziego am 13. Februar und die Besichtigung des Rebay-Hauses am 18. Mai.
Wirklichkeit wurde auch ein geplanter Stadtteiltreff Betzenhausen-Bischofslinde im Haus St. Albert. Dieser Stadtteiltreff arbeite seit Oktober 2013 unter der Trägerschaft des Caritasverbandes. Der besondere Dank Bischlers galt dem Gemeinderat der Stadt Freiburg, der Geschwister Staeb Stiftung, dem Caritasverband und der Pfarrei St. Albert, welche die Räume zur Verfügung stellt.
Der Bürgerverein setze sich weiterhin gemeinsam mit dem Verein »Bauernhoftiere für Stadtkinder« für ein Naherholungsgebiet im Gewann Obergrün ein. Verwunderung zeigte Nicolai Bischler mit Blick auf Bürgermeisterin Stuchlik, dass die Stadt, die so gern »green City« genannt werde, sich schwer damit tue, das umzusetzen, was sie eigentlich gern sein möchte!
Der traurigste Punkt sei, wie schon viele Jahre zuvor, der fehlende Ausbau des Freibades West. Geld sei bei der Stadt jetzt vorhanden, es sei Zeit, dieses Vorhaben jetzt anzugehen.
Erfreut konnte Bischler darauf hinweisen, dass noch in diesem Jahr der St.-Thomas-Turm durch die Stadt saniert werde. Abschließend betonte Bischler den Willen des Bürgervereins, sich für einen lebendigen Stadtteil zu engagieren. Er rief die Anwesenden dazu auf, die Chance zu nützen, sich einzubringen. Dazu gebe es viele Möglichkeiten in den Vereinen oder in den Arbeitskreisen des Bürgervereins.
Bürgermeisterin Gerda Stuchlik betonte, gern zu diesem Empfang gekommen zu sein. Sie bewundere dabei die Art und Weise, wie der Bürgerverein geführt werde. Auch sie habe ein anstrengendes Jahr hinter sich, ihr Blick habe sich dabei auf andere Schwerpunkte gerichtet, sie nannte beispielsweise die Eurokrise und die hohe Jugendarbeitslosigkeit in manchen Ländern. Freiburg habe sogar Einnahmenzuwächse, dann gab es die Bundestagswahl, sie freue sich, dass Freiburg jetzt von 3 Abgeordneten vertreten werde.
2014 werde auch geprägt von der Fußballweltmeisterschaft, aber auch von den anstehenden Kommunalwahlen. Hier sei besonders erfreulich, dass erstmals 16-Jährige zur Wahl dürften. Freiburgs Bevölkerung werde stets größer, es sei schwer, rechtzeitig genügend Wohnraum zu schaffen. Neben einer innerstädtischen Verdichtung müsse auch ein neuer großer Stadtteil geplant werden. Erfreulich sei auch, dass der TGV nach Freiburg käme. Immer mehr Menschen benutzten das Fahrrad. Bald seien die Gutachten zum SC Stadion zu beraten. Ein besonderes Augenmerk richte man auf den Ausbau von Kindertagesstätten, da sei Freiburg gut vorangekommen. Bei der Gerhart-Hauptmann-Schule entstehe eine große inclusive Kita. Alle Kinder sollen damit die gleichen Chancen für eine gute Bildung erhalten. Des weiteren müsse man die Energiewende vorantreiben. Es gebe somit viele große Aufgaben zu bewältigen.
Bürgermeister Hagenacker aus Teningen freute sich über die vielen Begegnungen in der erst einjährigen Partnerschaft mit Betzenhausen-Bischofslinde. Aus dieser Stadt-Land-Partnerschaft sei ein freundschaftliches Miteinander für immer mehr Menschen entstanden. Die Breisgau-S-Bahn sei mit zu einem Bindeglied für die Menschen geworden.
Bernhard Schätzle, Ortsvorsteher aus Lehen, ging auf die großartige 500-Jahr-Feier des Lehener Bundschuh von 1513 ein. Damals seien sich Lehen und Freiburg in großer Feindschaft gegenübergestanden. An den Festlichkeiten zu diesem Gedenken habe sich der Geschichts- und Kulturkreis Betzenhausen mit Thomas Hammerich an der Spitze, auch seine Frau sei stark eingebunden gewesen, in großartiger Weise beteiligt. Schätzle sprach dem Ehepaar großen Dank aus und überreichte ein Aquarell mit der Thomaskirche in Alt-Betzenhausen.
Ernst Lavori, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Freiburger Bürgervereine (AFB), gratulierte zur gelungenen Umgestaltung des Platzes Bischofslinde. Insgesamt müsse man in Freiburg eine Verdichtung mit Augenmaß angehen, um genügend neuen Wohnraum zu schaffen. Man müsse auch darauf achten, dass möglichst wenig zusätzlicher Lärm entstehe, davon gebe es inzwischen schon mehr als genug! Das bestehende Westbad sei zwar schön, im Sommer könne man es aber niemals mit dem früher bestehenden Freibad vergleichen. Dieses sollte unbedingt von Grund auf renoviert werden.
Für die drei Kirchen sprach Regina Schiewer. In der Matthäusgemeinde kooperiere man in sehr guter Weise mit dem Jugendzentrum Chummy. Das gleiche gelte mit der Sozialstation. Man wolle insgesamt der Vereinsamung der Gesellschaft entgegenwirken. Der Mensch solle Gott nahekommen.
Für SUBI sprach Claudia Blum. Dies sei mit einem Jahr Alter wohl der jüngste Verein. Man habe sich aber aktiv am Einweihungsfest im vergangenen Juni beteiligt. Jetzt gelte es, intensiv an der Umgestaltung der Sundgauallee mitzuarbeiten.
Die Leiterin des Stadtteiltreffs Angela Schnaiter schilderte diesen als Anlaufstelle für die Menschen im Stadtteil. Die offizielle Eröffnung sei auf den 15. März gelegt worden, dazu sei die Bevölkerung herzlich eingeladen.
Nach diesem Programmteil traf sich die große Besuchergemeinde zum Stehempfang. Da bildeten sich rasch kleinere immer mal wieder wechselnde Gesprächsgruppen bei einem guten Tröpfchen und feinem Gebäck.
Harald Albiker
Beitrag aus Bürgerblättle 224, Febr./März 2014

 Bis zuletzt waren die Bauarbeiter damit beschäftigt, den neuen Platz am Bischofskreuz fertig zu stellen. Und das Ergebnis konnte sich wirklich sehen lassen! »Es liegt nicht nur eine harte Phase der Bauzeit hinter uns, sondern auch eine lange und intensive Zeit der Vorbereitung, Planung und Abstimmung mit den Behörden, den Anwohnern und Gewerbetreibenden«, so Nicolai Bischler, Vorsitzender des Bürgervereins Betzenhausen-Bischofslinde. Bischler machte noch einmal deutlich, dass die Eröffnung des Platzes nicht das Ende der Aktivierungsmaßnahmen im Stadtteil bedeutet – im Gegenteil! Es geht fließend weiter mit den Planungen der Sundgauallee, des Betzenhauser Torplatzes und der Haltestellen- sowie Gleissanierung.
Bis zuletzt waren die Bauarbeiter damit beschäftigt, den neuen Platz am Bischofskreuz fertig zu stellen. Und das Ergebnis konnte sich wirklich sehen lassen! »Es liegt nicht nur eine harte Phase der Bauzeit hinter uns, sondern auch eine lange und intensive Zeit der Vorbereitung, Planung und Abstimmung mit den Behörden, den Anwohnern und Gewerbetreibenden«, so Nicolai Bischler, Vorsitzender des Bürgervereins Betzenhausen-Bischofslinde. Bischler machte noch einmal deutlich, dass die Eröffnung des Platzes nicht das Ende der Aktivierungsmaßnahmen im Stadtteil bedeutet – im Gegenteil! Es geht fließend weiter mit den Planungen der Sundgauallee, des Betzenhauser Torplatzes und der Haltestellen- sowie Gleissanierung. Thomas Hammerich, Vorsitzender des Kultur- und Geschichtskreises, eröffnete den Festakt zum 500-jährigen Bundschuhjubiläum. Bernhard Schätzle, Ortsvorsteher aus Lehen begrüßte die Ehrengäste: Neben Oberbürgermeister Dieter Salomon und mehreren Stadträt(inn) en war eine Delegation aus Untergrombach angereist, der Heimat von Jos Fritz. Die Ehre gaben sich auch Prof. Horst Buszello (Vortrag am 16.3.) und Prof. Masahisa Deguchi aus Japan sowie der Politologe und Soziologe Thomas Adam, der den Festvortrag »Für Freiheit und Gerechtigkeit, Jos Fritz und der Bundschuh im Breisgau 1513« übernommen hatte. Zum musikalischen Auftakt bot Dirigent Wilhelm Schmid mit seinen Lehener Musikern die Sätze »basse danse« und »saltarello« eines Komponisten aus dem 16. Jahrhundert.
Thomas Hammerich, Vorsitzender des Kultur- und Geschichtskreises, eröffnete den Festakt zum 500-jährigen Bundschuhjubiläum. Bernhard Schätzle, Ortsvorsteher aus Lehen begrüßte die Ehrengäste: Neben Oberbürgermeister Dieter Salomon und mehreren Stadträt(inn) en war eine Delegation aus Untergrombach angereist, der Heimat von Jos Fritz. Die Ehre gaben sich auch Prof. Horst Buszello (Vortrag am 16.3.) und Prof. Masahisa Deguchi aus Japan sowie der Politologe und Soziologe Thomas Adam, der den Festvortrag »Für Freiheit und Gerechtigkeit, Jos Fritz und der Bundschuh im Breisgau 1513« übernommen hatte. Zum musikalischen Auftakt bot Dirigent Wilhelm Schmid mit seinen Lehener Musikern die Sätze »basse danse« und »saltarello« eines Komponisten aus dem 16. Jahrhundert. Dem Referenten wurde für seinen temperamentvollen Vortrag mit tosendem Beifall gedankt. Der Bundschuh von 1513 scheiterte, so ergänzte Thomas Hammerich, und endete mit Todesurteilen für die Bauern. Rechne man die Bauernkriege dazu, so müsse man wohl 50 000 tote Bauern beklagen. Dennoch sei bei der Regierung die Angst vor einer Empörung des Volkes umgegangen und man habe sich deshalb zu pragmatischem Umgang mit dem »gemeinen Mann« gezwungen gesehen. Aus Furcht vor neuen Bundschuhaufständen warnten die Reichsstände deshalb vor einer Bekämpfung Martin Luthers.
Dem Referenten wurde für seinen temperamentvollen Vortrag mit tosendem Beifall gedankt. Der Bundschuh von 1513 scheiterte, so ergänzte Thomas Hammerich, und endete mit Todesurteilen für die Bauern. Rechne man die Bauernkriege dazu, so müsse man wohl 50 000 tote Bauern beklagen. Dennoch sei bei der Regierung die Angst vor einer Empörung des Volkes umgegangen und man habe sich deshalb zu pragmatischem Umgang mit dem »gemeinen Mann« gezwungen gesehen. Aus Furcht vor neuen Bundschuhaufständen warnten die Reichsstände deshalb vor einer Bekämpfung Martin Luthers.


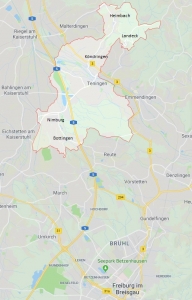 Bottingen
Bottingen Zuvor hatte Teningens Bürgermeister Heinz-Rudolf Hagenacker in seinem Grußwort auf die Bedeutung einer Stadt-Land-Partnerschaft hingewiesen: Man sei aufeinander angewiesen. Freiburg und seine Umgebung seien eine Wachstumsregion, deren Probleme gemeinsam gelöst werden müssten. In weiteren Grußworten ging es um eine Wiedereröffnung des Außenbeckens im Westbad (Bergamelli), um das Bundschuhjubiläum für Lehen und Betzenhausen (Schätzle, Hammerich), um gute Zusammenarbeit aller Kindergärten im Stadtteil, eine gute Infrastruktur für Familien mit gutem Wohnen, das gute Miteinander des Jugendzentrums Chummy mit den Anwohnern sowie einer notwendigen Zusammenarbeit aller Menschen im Stadtteil (Baiker, Kirchengemeinden).
Zuvor hatte Teningens Bürgermeister Heinz-Rudolf Hagenacker in seinem Grußwort auf die Bedeutung einer Stadt-Land-Partnerschaft hingewiesen: Man sei aufeinander angewiesen. Freiburg und seine Umgebung seien eine Wachstumsregion, deren Probleme gemeinsam gelöst werden müssten. In weiteren Grußworten ging es um eine Wiedereröffnung des Außenbeckens im Westbad (Bergamelli), um das Bundschuhjubiläum für Lehen und Betzenhausen (Schätzle, Hammerich), um gute Zusammenarbeit aller Kindergärten im Stadtteil, eine gute Infrastruktur für Familien mit gutem Wohnen, das gute Miteinander des Jugendzentrums Chummy mit den Anwohnern sowie einer notwendigen Zusammenarbeit aller Menschen im Stadtteil (Baiker, Kirchengemeinden). Erstmals durften alle Gäste beim Neujahrsempfang des Bürgervereins im großen Saal Platz nehmen. Der Grund, so der Vorsitzende des Bürgervereins, Thomas Hammerich, bei seinen Grußworten, sei ein Film, den Schüler(innen) der Gerhart-Hauptmann-Schule zum 100-jährigen Bestehen der Schule im letzten Jahr unter der Leitung der Lehrerin Caroline Braun aufgenommen hatten. Diesen sollten die Besucher auf bequemen Stühlen genießen! Zuvor hatte Thomas Hammerich neben MdL Bernhard Schätzle einige Stadträte/-innen aus den Nachbarstadtteilen, die langjährige Ortschaftsratsvorsitzende von Lehen, Sigrun Löwisch, die beiden Pfarrer des Stadtteils sowie einige Ehrenmitglieder begrüßen können.
Erstmals durften alle Gäste beim Neujahrsempfang des Bürgervereins im großen Saal Platz nehmen. Der Grund, so der Vorsitzende des Bürgervereins, Thomas Hammerich, bei seinen Grußworten, sei ein Film, den Schüler(innen) der Gerhart-Hauptmann-Schule zum 100-jährigen Bestehen der Schule im letzten Jahr unter der Leitung der Lehrerin Caroline Braun aufgenommen hatten. Diesen sollten die Besucher auf bequemen Stühlen genießen! Zuvor hatte Thomas Hammerich neben MdL Bernhard Schätzle einige Stadträte/-innen aus den Nachbarstadtteilen, die langjährige Ortschaftsratsvorsitzende von Lehen, Sigrun Löwisch, die beiden Pfarrer des Stadtteils sowie einige Ehrenmitglieder begrüßen können.


